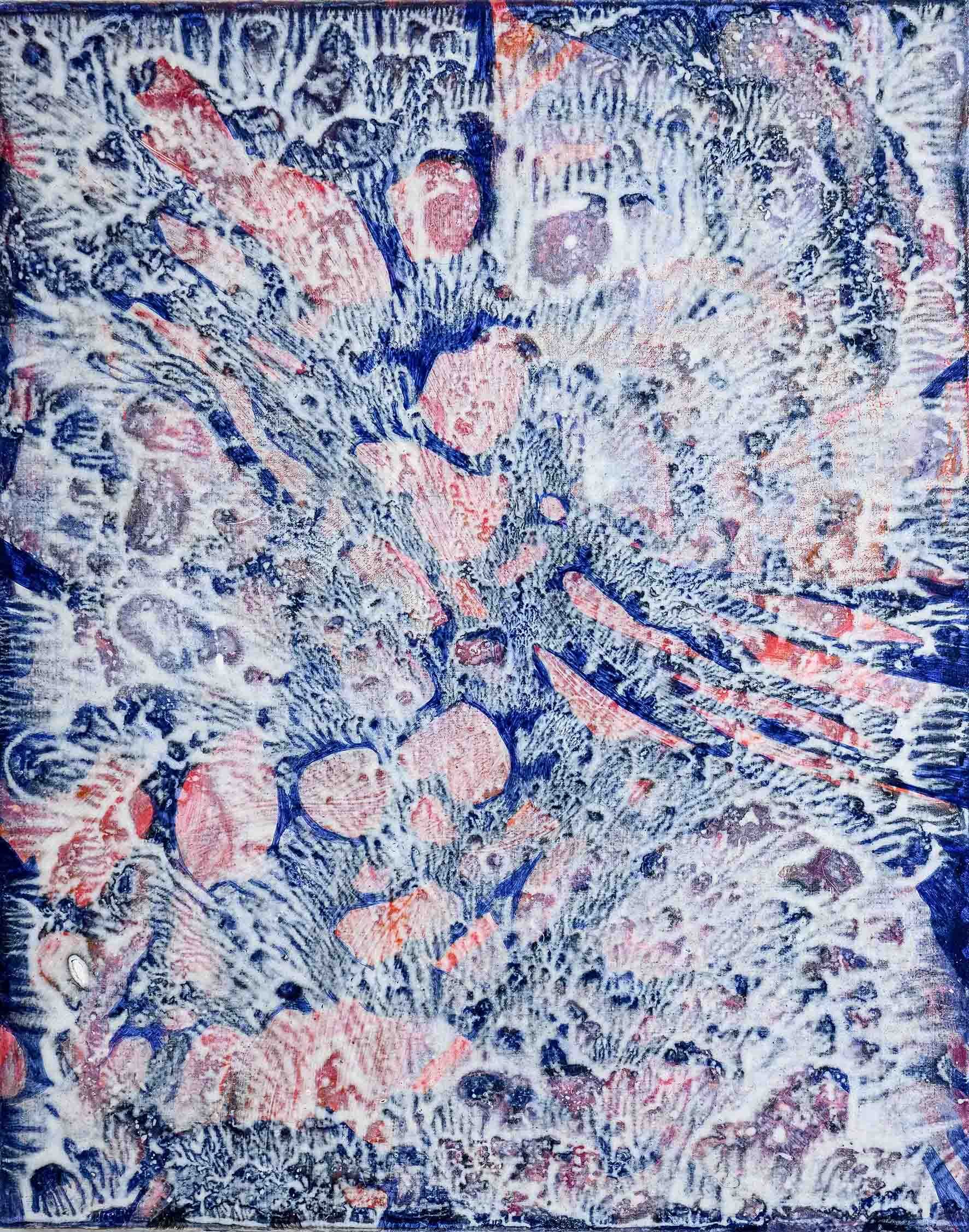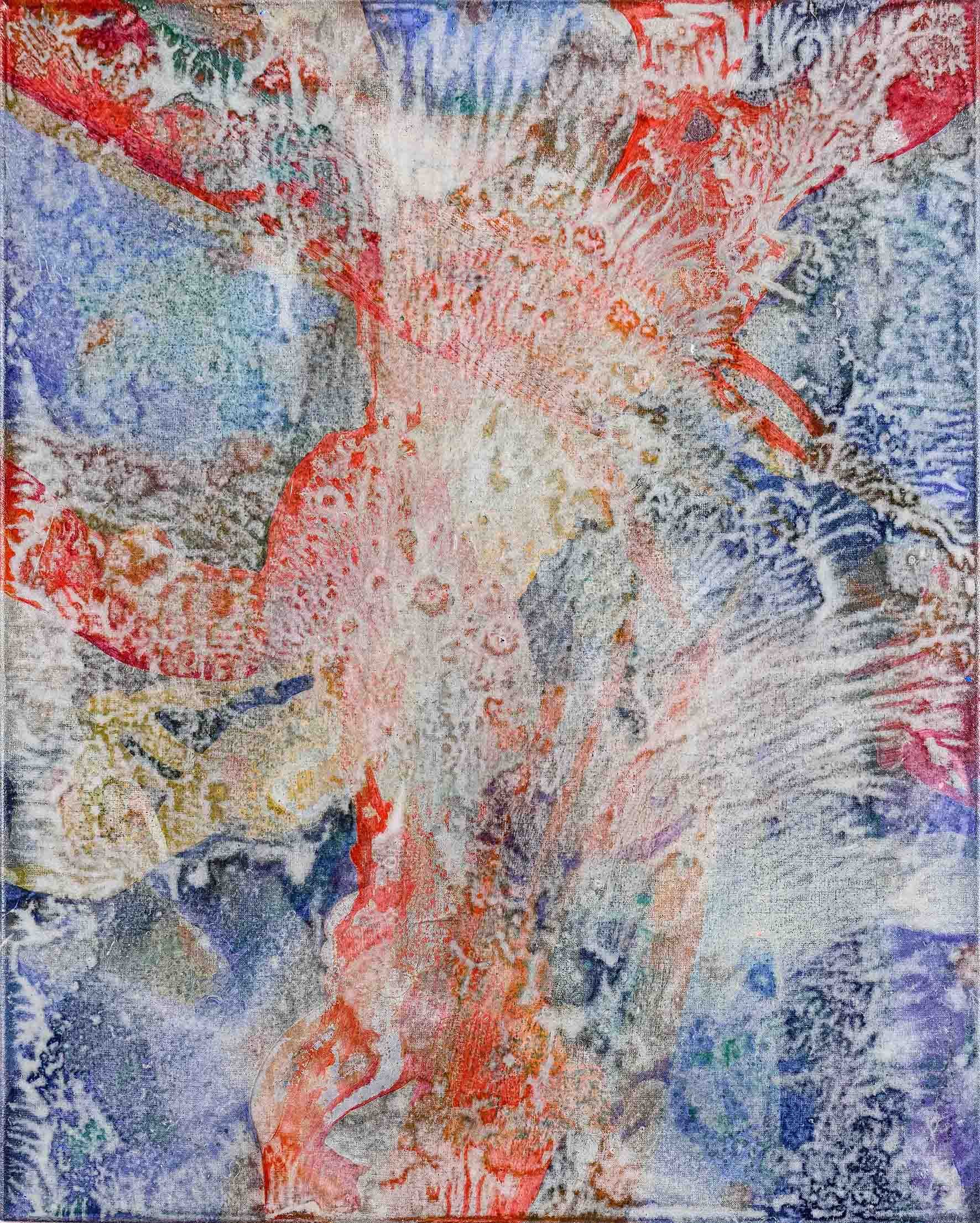DEEP SEA GENESIS
2023
50 × 40 × 2 cm (35) & 100 × 80 × 5 cm (5)
Öl und Acryl auf Leinen
Dr. Alexander Leinemann
Textbeitrag: Katharina Kühne (Katalogbeitrag Lüneburg)
„Nicht viel zu sehen - Katharina Kühnes Serie „Deep Sea Genesis" (2023)
Die Serie Deep Sea Genesis (2023) der deutschen Künstlerin Katharina Kühne
verweist bereits in ihrer Betitelung auf einen dem Menschen seit Beginn seiner
Existenz innewohnenden Drang: dem uneingeschränkten Verlangen nach
allumfassender Einsicht.
Die Erschließung des Unbekannten hat sich bis zum heutigen Tag in das kollektive
Gedächtnis des Menschen eingebrannt. Wir wollen mehr sehen, mehr erleben und
allumfassende Antworten auf die unzähligen Fragen unserer Umwelt erhalten. Doch
so vehement die Unebenheiten der Welt auch erschlossen und einem Verlangen
nach Kontrolle und Nutzbarmachung unterstellt wurden, entziehen sich bis zum
heutigen Tag einige Gegebenheiten weiterhin auf unabdingbare Weise der
menschlichen Vereinnahmung. Unerforschte Orte üben dabei eine fast magische
Anziehungskraft auf den Menschen aus, auch wenn das Aufspüren dieser des
Öfteren von lebensfeindlichen Umständen bestimmt wird. Einer dieser Orte und
zugleich der Ausgangspunkt der künstlerischen Auseinandersetzung in der Serie
Deep Sea Genesis ist die Tiefsee.
Das vermeintlich greifbare Abenteuer
Auch wenn neuartige Vermessungsmethoden erstaunliche Ergebnisse über die
Beschaffenheit und die Ausmaße der Tiefsee zu Tage fördern konnten, verweilt
jedoch weiterhin vieles im Unklaren. Ab einer Tiefe von etwa 200 Metern
beginnend, erschaffen immenser Druck, Lichtlosigkeit, dynamische
Strömungsverhältnisse und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt ein allgemeines
Umfeld, das für den Menschen nur unter Hinzunahme höchst aufwendiger Technik
erschlossen werden kann. Eine Unternehmung wie beispielsweise das Ocean-Gate
Projekt, bei dem auf dem Weg zum Wrack der Titanic fünf Menschen aufgrund
mangelhafter technischer Voraussetzungen ums Leben kamen, stellt nicht nur ein
zeitnahes Ereignis von tragischem Ausgang dar, das die Gefahren der Tiefsee eklatant
unterschätzt hat.1 Das Unglück verdeutlicht die überhebliche Vehemenz,
mit der der Mensch versucht, die Tiefsee zu einem mystisch-erlebbaren Abenteuer
zu gestalten, das allein seinen Vorstellungen von kommerzieller Nutzbarkeit
unterliegt. Ein gedachtes Abenteuer kapitalistischer Aneignung, das, getreu der
bereits im 19. Jahrhundert im Zuge der Erschließung des amerikanischen Westens
entstandenen Formulierung „Go West", einem über allem stehenden, direktiven
Sendungsbewusstsein folgt. Die verinnerlichte Vorstellung unzähmbaren
Fortschritts macht dabei nicht nur aus dem Unbekannten der Tiefsee einen um jeden
Preis sich anzueignenden Warenkörper. In einer solchen Auffassung erscheint das in
einer Tiefe von 3800 Metern liegende Wrack der Titanic nur noch als
oberflächliches Überbleibsel einer kommerzialisierten Auffassung von Geschichte,
die dem touristisch-erlebbaren Abenteuer zum Opfer gefallen ist.
Das fotografische Bild ist dabei zur inoffiziellen Währung einer Konsumentenschafft
geworden, die dem Irrglauben an die Greifbarkeit des Moments erliegen ist. Das
Foto dient nicht dazu, die Welt einer universellen Befragung auszusetzen und
tiefergehende Erkenntnisse über ihre Beschaffenheit zu erhalten. Das repetitive,
nach Authentizität und Echtheit strebende und in den Untiefen der sozialen
Netzwerke geteilt Beweisfoto legitimiert letztendlich nur die Existenz einer erhofften
und doch trivialen eigenen Handlung.
Die Künstlerin Katharina Kühne erschafft ein vollkommen anderes Bild der Tiefsee.
Sie sucht nicht nach Abbildern historischer Bewandtnis. Ihre Wahrnehmung führt zu
malerischen Setzungen, die in unterschiedlichster Ausprägung etwas zum Vorschein
bringen, was kein Foto der Tiefsee jemals abzubilden in der Lage sein wird. Ihre
umfangreiche Serie Deep Sea Genesis widmet sich einem universellen Ursprung,
dessen Befragung nicht nur den Blick auf die Tiefsee gerichtet, sondern grundlegend
den Fokus auf die Welt ausgerichtet hat.
Wo ist denn nun der Inhalt?
Am 24. Februar 2024 eröffnete das Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum eine Ausstellung mit
dem Titel „Nicht viel zu sehen. Wege der Abstraktion 1920 bis heute". In dieser präsentiert
das Museum eine außerordentliche Fülle an Werken, die sich auf unterschiedlichste Weise mit der
Abstraktion auseinandergesetzt haben. In Anlehnung an das Gemälde Not much to look at (Nicht
viel zu sehen) (1959) des französischen Malers Jean Fautriers (1898-1964), ist nicht nur der
dementsprechend adaptierte Titel der Ausstellung einzuordnen. Eine Konfrontation mit einer
spezifischeren „Schulung des Sehens"2 im Angesicht scheinbar nichtssagender Bilder, lässt die
Frage präsent werden: Was sehen wir überhaupt auf Gemälden, die sich der Wiedergabe der allgemeinen
Betrachtung der Welt scheinbar entzogen haben?
Die Befragung von dem, was wir sehen, folgt hauptsächlich einem Prozess von exakt
ausgerichteter Identifikation. Eine fehlende Einsicht, bleibt der sofortige Zugang
zum Gesehenen aufgrund fehlender Ähnlichkeitsrelationen aus, sorgt dabei rasch
für Unmut, der bisweilen in Verachtung und forcierte Diskreditierung umschlagen
kann. Prägnante Beispiele der Kunst des 20. Jahrhunderts, etwa die Gemälde des
amerikanischen Künstlers Jackson Pollock (1912-1956), verdeutlichen diesen
Umstand auf außerordentliche Weise:
»Das gängige Missverständnis von Pollocks Drip Paintings als dekorativer Meterware
entsprach dem schon der klassischen Moderne geltenden Urteil Sedlmayrs,
abstrakte Malerei regrediere zum leeren Muster. [ ... ] Das in zahlreichen
Pollock-Witzen und -Kommentaren wiederkehrende Verdikt gegen die Abstraktion als
leeres Muster geht historisch auf die Erfahrung der imitierten Ornamente, mit denen die
Fabrikproduktion seit der Mitte des 19. Jahrhunderts massenhaft und in beliebiger
Stilart und Technik die Gebrauchsgegenstände überzog.«3
Abstrakte Setzungen - Formen, die sich von der euklidisch-geometrischen
Geometrie unterscheiden, entstammen sie einem Prozess, der in seiner Gänze nicht
vollends denkbar und daher unkalkulierbare Resultate verinnerlicht - wurden in
ihrem künstlerischen Gehalt schon lange zum Opfer ausufernder Vergleiche erklärt,
war es doch weitaus leichter, das Gesehene den eigenen Limitierungen der
Vorstellungskraft auszusetzen. Das Phänomen der Pareidolie, ein Begriff, der sich
aus »zwei altgriechischen Worten, para übersetzbar mit „vorbei" oder „daneben"
und eidolon als „Bild", „Scheinbild" oder „Phantom"«4 zusammensetzt, sorgt bereits
seit Kindheitstagen dafür, in beispielsweise Wolken oder anderen spontan sich
ausbildenden Formgestalten, Dinge zu sehen, die eigentlich gar nicht anwesend
sind. Der Schauende evoziert somit auf das Gesehene eine Vorstellung seiner
Weltwahrnehmung, die zwar denkbar, aber letztendlich nichts mit dem Realen zu
tun hat. Ein abstraktes Gemälde, welches diesem Trugschluss zum Opfer gefallen ist,
wird in seiner Beziehung zum Betrachtenden stets distanziert eingeordnet sein, ohne
sein verinnerlichtes Potenzial universellen Gehalts preisgeben zu können.
Wenn das Unbekannte zum Bestandteil wird
Katharina Kühnes Serie Deep Sea Genesis besitzt das Potenzial einer ähnlich zu
benennenden Rezeptionsabsicht unterstellt zu werden, die sich vom Realen der
Bilder grundlegend entfernt. Die abstrakten Bilder laden dazu ein, Formgestalten
eigener Vorstellungskraft in ihnen zu platzieren. Dadurch findet zwar ein Austausch
mit den Bildinhalten statt. Dieser stellt jedoch nur durch einen gedachten
Stellvertreter- eine denkbare Form - einen Zugang zum Bild her, ohne aber auf das
einzugehen, was Kühne in ihrer Serie zum Ausdruck bringen konnte: Ein
tiefgreifendes und mit der Kunst erst zur Sichtbarkeit zu überführendes Verständnis
für das Unbekannte in der Welt. Die »idealistische Allmacht der Gedanken«5 merkt
dabei gar nicht, dass ihre Rezeptionsabsicht sich Stück für Stück von dem entfernt,
was sie eigentlich versucht zu erschließen und zu begreifen. Jedes Werk der
umfangreichen Serie versucht nicht, einem vorrangig formulierten
Darstellungsparadigma zu folgen, sondern begreift das übergeordnete Themenfeld
der Tiefsee als etwas, das in seiner Komplexität nicht durch eine Form der Malerei
erschlossen werden kann, die allein ein Abbild der Tiefsee darzustellen versucht.
Kühnes Malerei gibt sich vielmehr den dynamisch verlaufenden Prozessen, den
unkalkulierbaren Gegebenheiten, den Risiken und Gefahren hin, die eine
malerische Auseinandersetzung mit der Tiefsee letztendlich ergeben, wird das
Unbekannte als etwas begriffen, das nur dann zur Darstellung überführt werden
kann, wenn es selbst zum Bestandteil des Schaffensprozesses wird. Die Werke der
Serie Deep Sea Genesis offerieren dem Betrachtenden ein zum Bild gewordenes
Verständnis der Welt, die mit Hilfe der Kunst als etwas begriffen wurde, das keinen
statischen Vorgaben folgt. Eine Kunst wie die Katharina Kühnes, die außerhalb
vorgefertigter Überlegungen und engstirniger Absichten agiert und sich dem
Unbekannten auf inkludierende Weise stellt, zeigt, wie ein Zugang zur Welt mit Hilfe
von Kunst entstehen kann, der all das Unerklärliche akzeptiert: »Kunst ist
unvorhersehbar, sie entsteht oder verschwindet in einem Prozess, der nicht linear ist
und von ständigen Rückkoppelungen chaotischer oder zufälliger Ereignisse traktiert
wird.«6
1 URL: https://www.tagesschau.de/ausland/tauchboot-titanic-suche-100.html (Letzter Zugriff: 13.04.2024).
2 URL: https://von-der-heydt-museum.de/ ausstellungen/nicht-viel-zu-sehen/ (Letzter Zugriff: 13.04.2024).
3 Prange, Regine/Diers, Michael (Hg.): Jackson Pollock Number 32, 1950. Die Malerei als Gegenwart, Frankfurt/M. 1 996, S. 66.
4 Schwerdtfeger, Paula: ,,Das Hirngespinst der belebten Bilder", in: Schwerdtfeger, Paula: Formen, die ihr Wesen treiben (Ausst. Kat. Hannover Sprengel Museum, 14. Juli-3. Oktober 2021), Hannover 2021, S. 9-19, hier: S. 11.
5 Prange/Diers 1 996, S. 75.
6 Sasse, Jörg: ,,Ein paar Zeilen zu Netzwerken. Bemerkungen zu Information und Macht", 2009.
Onlinezugriff über die Bereitstellung auf der Internetseite des Künstlers:
URL: https://www.c42.de/text.php?tid=1 (Letzter Zugriff: 13.04.2024).